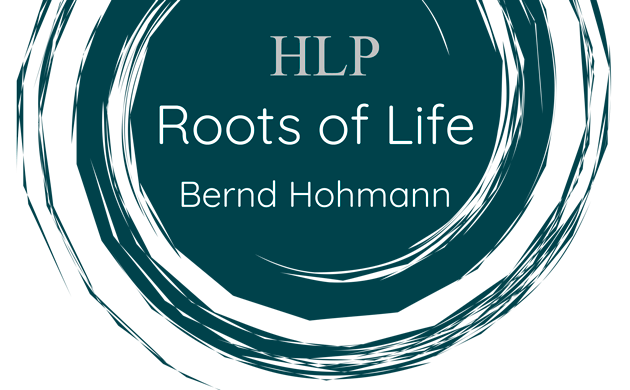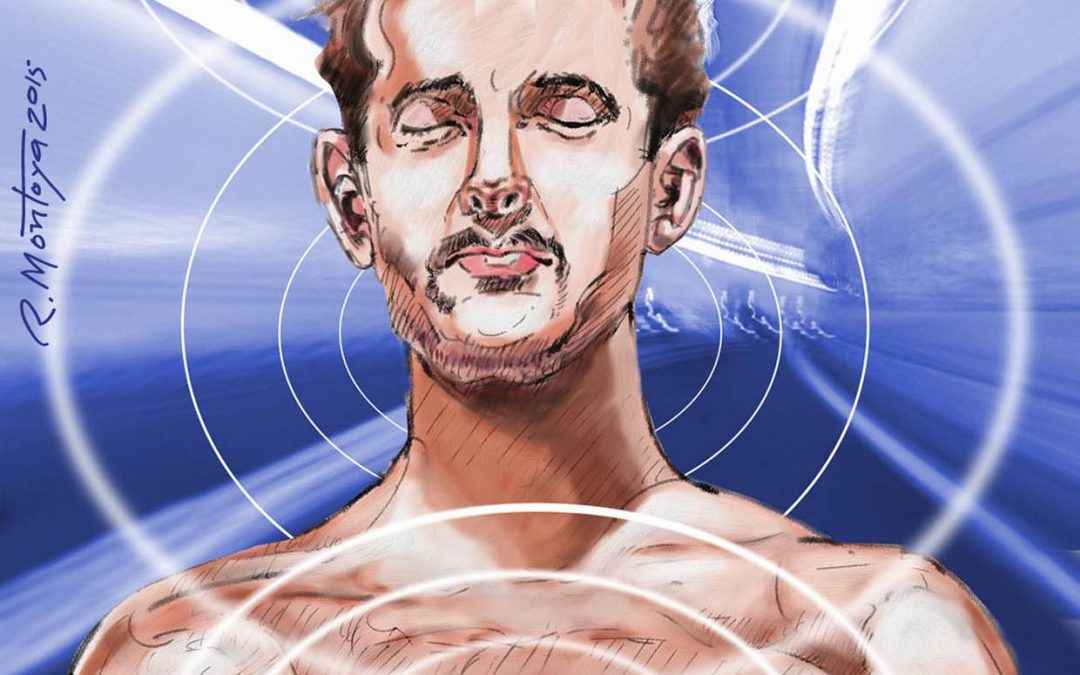„Veränderungen im Management – Hindernisse und Anreize“
1. Was ist Veränderung? – Definition, Beispiele, Studien
Leben ist ständige Veränderung
Laut dem freien Wörterbuch Wiktionary ist Veränderung „der Wechsel von einem (alten) Zustand in einen anderen (neuen)“. Demnach ist unser Leben tatsächlich eine ständige Veränderung. Denn auf der Zeitachse reihen sich alte Zustände und neue Zustände fortlaufend aneinander.
Dennoch erleben wir diese permanente Veränderung subjektiv nicht als Veränderung, solange sie nicht vom Gewohnten abweicht. Eine wichtige Erkenntnis der Hirnforschung ist tatsächlich, dass nur solche Informationen und damit auch Veränderungen bewusst von unserem Gehirn als Veränderungen aufgenommen und verarbeitet werden, die neu, ungewohnt und damit unerwartet sind. Und das, was tagtäglich routinemäßig an fortlaufender Veränderung in unserem Leben abläuft, ist nicht neu, sondern ist zu einem großen Teil Gewohnheit. Und wird deshalb von uns als Kontinuität und als Stabilität und nicht als Veränderung wahrgenommen.
Dieser Beitrag soll sich nun aber sinnvollerweise mit den für uns Menschen neuen, ungewohnten und unerwarteten Veränderungen bezogen auf das Management beschäftigen.
Und diese sind uns häufig erst einmal gar nicht willkommen.
Einige Beispiele für aktuelle Veränderungen
Aktuelle Beispiele für Ereignisse mit teilweise einschneidenden Veränderungen für unsere Unternehmen sind die Digitalisierung, der Klimawandel, die Corona Pandemie und der Ukrainekrieg. Und bei diesem letzten vollkommen unerwarteten Ereignis sind die Auswirkungen und damit Veränderungen insbesondere in unserer Wirtschaft bisher überhaupt noch nicht absehbar. Weitere Veränderungsprozesse betreffen den zunehmenden Fachkräftemangel, ein sich änderndes Führungsverständnis und den Strukturwandel von Industriezweigen wie aktuell schon der Autoindustrie.
Veränderungen im Management sind ein Megatrend der Zukunft
Veränderungen im Sinne des Verständnisses dieses Beitrages sind also ein Megatrend der Zukunft. Sie werden in Zukunft immer grundsätzlicher und einschneidender werden und an Häufigkeit noch deutlich zunehmen. Deshalb ist es für viele Unternehmen nicht selten sogar existentiell wichtig, ihre Kompetenzen beim Managen von Veränderungen weiterzuentwickeln.
Die Dringlichkeit der Weiterentwicklung dieser Veränderungskompetenzen wird durch die Ergebnisse aktueller Studien zum Erfolg von Change-Projekten in Unternehmen noch zusätzlich verstärkt. Laut Harvard Business Review liefern 75% der offiziellen Veränderungsmaßnahmen nicht die erwarteten Ergebnisse. Und McKinsey´s Studie weist 70% der Change-Projekte als Misserfolg aus.
Welches sind die Ursachen für misslungene Change-Projekte
Die Ursachen für das Misslingen von Change-Projekten wird häufig in einer falschen Projektplanung, fehlenden Ressourcen, unklar definierten Prozessen und Zielen gesehen.
Die Rolle der Menschen bei der Planung und Durchführung von Veränderungsprozessen wird bei der Evaluation von gescheiterten Change-Projekten aber sehr oft vernachlässigt.
Wir Menschen haben aber trotz aller Technisierung weiter eine Schlüsselrolle für das Gelingen von Change-Projekten. Deswegen ist es dringend erforderlich, bei der Planung und Durchführung von Veränderungsprozessen die aktuellen Erfahrungen und Erkenntnisse der Wissenschaft und der Praktiker über uns Menschen viel stärker zu nutzen.
2. Mensch und Veränderung – wie funktioniert unser Gehirn – vier entscheidende Grundregeln
Welche Inhalte können Sie von diesem Beitrag erwarten?
Dieser Beitrag beschäftigt sich also im ersten Teil damit, wie wir Menschen aus Sicht von Neurowissenschaft und Psychologie bezogen auf Veränderungen „funktionieren“.
Und diese Erkenntnisse der Gehirnforschung und Psychologie sind außerordentlich wertvoll, um besser zu verstehen, warum viele Menschen Veränderungen nicht mögen. Und warum die Verantwortlichen für Veränderungsprozesse sehr häufig mit Hindernissen oder sogar Widerständen gegen Veränderung zu kämpfen haben.
Im zweiten Teil dieses Beitrages wird dann aufgezeigt, wie die Schlüsselpersonen von Change-Projekten diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen können, um Veränderungsprozesse erfolgreicher zu gestalten. Um also die Veränderungsbereitschaft der Beteiligten gemeinsam mit den Beteiligten zu erhöhen.
Als erstes sollen hier also vier zentrale Grundregeln – „Algorithmen“, wie unser menschliches Gehirn funktioniert, dargestellt werden.
Regel 1 – unser Gehirn ist ein leidenschaftlicher Energiesparer
Unser Gehirn versucht und das auch ohne unser bewusstes Dazutun alle Aktivitäten zu vermeiden, die Energie verbrauchen. Energie vorrangig in Form von Glucose und Sauerstoff.
Im Ruhezustand verbraucht unser Gehirn bereits 20% und in Gefahren-/Stresssituationen bis zu 80% der von unserem gesamten Organismus benötigten Energie.
Da das Gehirn keinen eigenen Energiespeicher hat, entzieht es bei verstärkter Tätigkeit insbesondere bei Stress dem Körper die benötigte Energie. Diese Energie fehlt dann den restlichen Körperfunktionen. Dies ist bei anhaltendem Stress stark gesundheitsschädlich.
Bereits frühzeitig in der Entwicklung des Gehirns von Säugetieren, hat damit das Gehirn ein Programm zur Einsparung von Energie entwickelt. Insbesondere auch um in lebensbedrohlichen Situationen genügend Energie für die Erhaltung der eigenen Existenz zur Verfügung zu haben. Diese frühe Programmierung des Gehirns ist in tiefen Schichten unseres menschlichen Gehirns bis heute erhalten und bestimmt die Art, wie wir Menschen funktionieren grundlegend.
Alles, was zusätzliche Energie verbraucht, versucht unser Gehirn zu vermeiden
Jegliche Tätigkeiten, die verstärkt Energie benötigen, werden deshalb unbewusst von unserem Gehirn zunächst einmal vermieden oder zumindest weitestgehend reduziert. Dies betrifft insbesondere das Erlernen neuer Verhaltensweisen und Kompetenzen. Aber auch kognitive Tätigkeiten wie Analysieren, Verstehen, Lösungen finden, sich auf andere Menschen oder Situationen konzentrieren, Zuhören, sich in andere Menschen hineinversetzen u.a. erfordern einen erhöhten Energieverbrauch. Und unser Gehirn versucht sie automatisch auch zunächst einmal einzuschränken.
Gewohnheiten sparen unglaublich viel Energie
Unser Gehirn versucht deshalb schon fast „zwanghaft“ alles, was wir Menschen fühlen, denken und tun, zu automatisieren. Und dies gelingt dem Gehirn mit großem Erfolg, denn ca. 85% unserer menschlichen Aktivitäten laufen in gleicher oder ähnlicher Form wiederkehrend als Gewohnheiten ab. Das salopp klingende Sprichwort „der Mensch ist ein Gewohnheitstier“ hat also hohen Wahrheitsgehalt.
Aber auch das Denken in Kategorien, Strukturen, Schubladen und Vorurteilen sowie unser beliebtes sogenanntes „schwarz-weiß Denken“ ist mit weniger Arbeit verbunden und spart deshalb Energie.
Die meisten Menschen mögen Veränderungen von Natur aus nicht
Veränderungen und damit auch Change-Projekte erfordern also einen erhöhten Energieeinsatz von den betroffenen Menschen. Und diesen erhöhten Energieverbrauch durch Veränderungen versuchen wir deshalb natürlicherweise zunächst einmal zu vermeiden. Und viele von uns erleben Veränderungen deshalb als unangenehm.
Wir wissen dank dieser Forschungsergebnisse mittlerweile, warum die meisten Menschen Veränderungen natürlicherweise erst einmal nicht mögen. Es ist deshalb durchaus sinnvoll, mehr Verständnis für die Abneigung und den Widerstand vieler Menschen gegen Veränderungen zu haben. Und wir sollten verstärkt Wege finden, wie wir diese natürliche Abneigung von Beteiligten von Change-Prozessen verringern können. Und wie wir die Betroffenen für die aktive, konstruktive Mitarbeit in Change Prozessen gewinnen können.
Regel 2 – unser Gehirn ist ein „fanatischer Fan“ angenehmer Zustände
Bereits vor der Geburt und dann zunehmend in den ersten Lebensjahren bewertet unser Gehirn fortlaufend, welche unserer Erfahrungen angenehm und welche unangenehm sind.
Welche Gedanken, Gefühle und Tätigkeiten Bedürfnisbefriedigung und damit Lust und Wohlbefinden in uns Menschen erzeugen und welche Schmerz, Unlust und Unwohlsein auslösen.
Auf diese Art sorgt unser Gehirn dafür, dass wir Menschen alles Angenehme wiederholen und erneut aufsuchen und alles Unangenehme vermeiden und abwehren.
Diese permanente Evaluierung unseres Erlebens und die daraus abgeleitete Steuerung unserer Aktivitäten findet vollkommen automatisiert statt. Und beides erfolgt zunächst auch einmal ganz unbewusst. Die Ergebnisse dieser Bewertungs- und Steuerungsprozesse können wir uns aber zumindest teilweise willentlich bewusst machen.
Viele Menschen versuchen Veränderungen zu vermeiden, weil sie unangenehm sind
Durch diese Grundprogrammierung der Tätigkeit unseres Gehirns lernen wir in der frühen Kindheit, was uns motiviert, weil es für uns angenehm ist. Und wir entwickeln auf diese Art ein Leben lang überwiegend unbewusst Verhaltensgewohnheiten, die angenehme Zustände in uns erzeugen und unangenehme vermeiden. Da nun aber Veränderungen häufig nach unserem Erleben recht unangenehm sind, versucht unser Gehirn und damit wir Menschen auch aus diesem Grunde zunächst einmal, Veränderungen zu vermeiden.
Regel 3 – Vernunft und Einsicht haben keinen direkten Einfluss auf unser Verhalten
Diese Grundregel unserer Gehirnfunktion ist für jeden, der bisher glaubte, Einsicht ist der Schlüssel für menschliche Verhaltensänderung eine herbe Enttäuschung.
Nach dieser Regel ist Einsicht in die Notwendigkeit einer Veränderung zwar ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Veränderung. Einsicht allein hat aber noch keinen Einfluss darauf, dass Menschen ein Change-Projekt auch tatsächlich mittragen und in der Praxis nachhaltig umsetzen.
„Bauch gegen Kopf“ – wer kennt diesen Konflikt nicht?
Der Grund hierfür ist der uns Menschen sehr vertraute „Bauch versus Kopf“ – Konflikt. Mark Forster hat diesen Konflikt auf sehr melodische Art in seinem Song „Bauch und Kopf“
besungen. Im Refrain des Songs heißt es sehr treffend: „Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden steh‘ ich“.
Bezogen auf Veränderungsprozesse müsste dieser Refrain in Abwandlung heißen: „Kopf sagt zu Chef, ja, ich sehe die Notwendigkeit der Veränderung ein. Und Bauch sagt zu Kopf, nein, ich habe aber keine Lust dazu. Ich spüre keinerlei Motivation für diese Veränderung.“ Und damit bleibt es dann, wie so oft in Veränderungsprozessen, allein bei den Willensbekundungen der Beteiligten, denen in der Folge aber keine nachhaltigen Taten folgen.
Unser „Kopf“ befähigt uns zu Logik, Vernunft und Einsicht
Wie lässt sich dieses Dilemma neurowissenschaftlich erklären? Wir Menschen haben tatsächlich in unserem Gehirn einen Teil, der für den „Kopf“ steht. Dies sind die äußeren 6 Schichten unserer Großhirnrinde. Der Teil des Gehirns also, der direkt unter unserer Schädeldecke liegt. In diesem Bereich des Gehirns sind unsere Sprachzentren lokalisiert. Unser logisches Denken, das Analysieren von Sachverhalten, die Problemlösung und das Festlegen von Zielen finden hier statt. Und wir sind dank dieses Teils unseres Gehirns auch zu Vernunft und Einsicht in der Lage.
Für gute Ergebnisse müssen „Bauch und Kopf“ zusammenarbeiten
Allerdings hat dieser Gehirnbereich weder anatomisch noch funktional einen direkten Einfluss auf die verhaltenssteuernden Zentren unseres Gehirns. Dieser Teil unseres Gehirns kann also von sich aus allein kein Verhalten auslösen.
Damit also aus einer Problemlösung, einem Ziel und aus Einsicht tatsächlich nachhaltiges Verhalten wird, sollten sich diese Ergebnisse unserer kognitiven Tätigkeit mit dem „Bauch“ zusammentun. Und beide müssen dann an ein und demselben „Strang“ ziehen. Es ist also notwendig, dass wir für das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben und eingesehen haben, auch motiviert sind. Das heißt, einen Nutzen und Gewinn für uns selbst in unseren Zielen erleben.
Unser sogenannter „Bauch“ ist ebenfalls ein Teil unseres Gehirns
Verantwortlich für diese fundamental wichtige Motivation für unser Handeln ist der Teil von uns Menschen, den wir gerne so salopp „Bauch“ nennen. Dieser Teil von uns befindet sich aber nicht in unserem Bauch, sondern ist ebenfalls ein Bereich in unserem Gehirn. Und er wird repräsentiert durch zentrale Teile des limbischen Systems, genauer gesagt durch das Belohnungs- und Motivationssystem.
In diesen Arealen unseres Gehirns ist im Laufe unserer Entwicklung, wie oben beschrieben, festgelegt worden, was für uns Menschen angenehm und lustvoll ist. Und was wir deshalb fühlen, denken und vor allem tun müssen, um unsere Bedürfnisse auf diese wohltuende Art zu befriedigen. In diesen Teilen des limbischen Systems entsteht also unsere Motivation für unser Handeln.
Und diese Teile des Gehirns sind direkt mit den verhaltenssteuernden Gehirnzentren verbunden. Sie lösen also unser Verhalten aus. Sie motivieren uns dazu, uns ernsthaft und nachhaltig an einem Change-Projekt zu beteiligen.
Regel 4 – ohne Belohnung läuft gar nichts
„Ohne Belohnung läuft gar nichts“ ist die Überschrift eines Interviews, das Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, einer der besten deutschsprachigen Gehirnforscher, vor einigen Jahren der WirtschaftsWoche gegeben hat. Und er bestätigt damit auch noch einmal die Schlussfolgerungen, die im vorherigen Abschnitt hinsichtlich unserer Verhaltenssteuerung bereits genannt wurden.
Was ist für uns Menschen Belohnung und wie entsteht unsere Motivation?
Belohnung ist für uns auf jeden Fall schon einmal ein angenehmer Zustand, nach dem wir ja auf Grund der Grundprogrammierung unseres Gehirns fortlaufend streben. Und den wir entsprechend der Regel 2 (siehe oben) immer wieder neu erleben wollen.
Auf der Befindlichkeitsebene ist Belohnung der Zustand, den wir mit Zufriedenheit, Freude, Glück, Erfüllung und in besonders intensiver Qualität auch mit Euphorie, Rausch, Ekstase beschreiben.
Auf der chemischen Ebene wird beim Erleben von Belohnung in unserem Gehirn ein „magischer Cocktail“ verschiedener neuromodulatorischer Substanzen freigesetzt: Darunter auch Serotonin, das sogenannte „Glückshormon“, Oxytocin, das „Bindungshormon“ und verschiedene körpereigene Drogen, d.h. endogene Opioide und Endocannabinoide. Diese körpereigenen Drogen wirken auf uns Menschen genauso, wie die von außen zugeführte Drogen euphorisierend und rauscherzeugend.
Nach dem Gefühl von Belohnung können wir Menschen „süchtig“ werden
Dieses angenehme und mitunter sogar süchtig machende Gefühl der Belohnung entsteht immer dann, wenn eines oder mehrere unserer Bedürfnisse befriedigt werden. Diese Befriedigung erzeugt also ein Gefühl von Zufriedenheit, Glück, Freude u.a. Und die Erwartung, dass wir durch unser Handeln voraussichtlich eines oder mehrere unserer Bedürfnisse befriedigen können, treibt uns dazu an, zu handeln. Die Motivation für unser Verhalten ist also die Erwartung, dass wir durch unser Handeln in einen angenehmen Zustand versetzt werden. Und damit für unser Verhalten belohnt werden.
Motivation ist die Voraussetzung für unser Handel
Die Existenz eines Belohnungszentrums in unserem Gehirn und die Entstehung von Motivation durch Belohnungserwartung, ist schon seit fast 70 Jahren bekannt und zwischenzeitlich sehr umfangreich und zuverlässig untersucht worden. Dennoch haben diese für die Arbeit mit Menschen so fundamental wichtigen Erkenntnisse bisher leider nur wenig Bekanntheitsgrad und Anwendung in Schule, Bildung und Mitarbeiterführung gefunden.
Die Auswirkung hierfür sind allerorten zu beobachten insbesondere auch im Scheitern von Change-Projekten.
3. Mensch und Veränderung – unser Kohärenzgefühl
Bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Antonovsky erkannt, dass das Gefühl von Kohärenz ein wichtiger Schlüssel für die Gesunderhaltung von uns Menschen ist.
Die aktuelle Glücksforschung hat dieses Kohärenzmodell für die Erklärung der Entstehung von Glück erneut aufgegriffen. Damit wir Menschen glücklich, zufrieden und gesund sein können ist es nach diesem Modell erforderlich, dass wir die Welt um uns herum a. als verstehbar und erklärbar, b. als sinnhaft und c. als beeinflussbar erleben.
Damit die Betroffenen eines Veränderungsprozesses diesem Prozess zustimmen können, muss grundsätzlich auch erst einmal ein Kohärenzgefühl bei ihnen entstehen. Die Betroffenen eines Change-Projektes müssen die Notwendigkeit und den Ablauf der Veränderung verstehen können. Sie müssen diese als sinnvoll erleben. Und sie müssen das Gefühl haben, dass sie Einfluss auf den Veränderungsprozess nehmen können.
Ohne Kohärenzgefühl kann ein Change-Projekt nicht gelingen
Wenn also ein Management den Abteilungen A und B Anfang März eines Jahres mitteilt, dass Anfang April diese beiden Abteilungen aus Kostengründen zusammengelegt werden. Und dass die Mitarbeiter doch bitte Ende März in die neuen Räumlichkeiten umziehen sollen. Wenn die Betroffenen der Veränderung auf diese sehr knappe Art mit der Veränderung konfrontiert und dazu aufgefordert werden, sind alle drei Voraussetzungen a.-c. für ein Kohärenzgefühl nicht erfüllt.
Die betroffenen Mitarbeiter verstehen die Notwendigkeit der Veränderung nicht. Und sie erkennen Keinen Sinn in ihr. Und sie haben keinerlei Einfluss auf die Planung und Gestaltung des Veränderungsprozesses. Sie werden also unzufrieden und verärgert sein. Und der Widerstand von vielen von ihnen gegen diesen Veränderungsprozess wird hoch sein.
4. Wie können wir unsere Veränderungsbereitschaft erhöhen?
Um diese Frage zu beantworten, soll hier eine einfache Formel für Veränderungsbereitschaft als Grundlage genutzt werden.
Diese lautet: „Veränderungsbereitschaft = erwarteter Gewinn/Belohnung – erwartete Kosten (a+b+c)“. Leicht zu erkennen ist mit Hilfe dieser Formel, dass Menschen für eine Veränderung erst dann bereit sein werden, wenn der erwartete Nutzen/Gewinn der Veränderung höher ist als die erwarteten Kosten. Die Differenz aus beiden, der Wert für Veränderungsbereitschaft muss also positiv sein.
Kostenverringerung und Gewinnerhöhung steigert unsere Veränderungsbereitschaft
Wie können die Verantwortlichen eines Veränderungsprojektes nun aber die Bereitschaft der Beteiligten für die Veränderung erhöhen? Wie kann ein möglicherweise zunächst negativer Wert für Veränderungsbereitschaft ins Positive verbessert werden?
Dies kann auf zweierlei Art erreicht werden. Zum einen, indem die erwarteten Kosten der Veränderung gesenkt werden. Und zum anderen, indem die erwartete Belohnung erhöht wird. Sinnvollerweise sollte unbedingt an beiden Stellschrauben gedreht werden, wenn die Veränderungsbereitschaft für ein Change-Projekt erfolgreich erhöht werden soll.
Der erste wesentliche Kostenfaktor ist die Energie, die Veränderung benötigt.
Der erste wichtige Kostenfaktor von Veränderung ist, wie bereits bei Regel 1 dargestellt, die Energie die Veränderung benötigt. Und an dieser Stelle sagt unser Gehirn zunächst einmal: „Nein, das muss verhindert werden!“. Das Erlernen neuer Verhaltensweisen und Kompetenzen erfordert umfangreiche Umstrukturierungen in unserem Gehirn. Die Änderungen von jahrelang bestehenden Gewohnheiten und damit automatisierten Abläufen ist ebenfalls mit deutlich mehr Aktivität des Gehirns verbunden. Für Lernprozesse jeder Art benötigt unser Gehirn aber deutlich mehr Energie als im Ruhezustand.
Wie kann der Energieverbrauch unseres Gehirns reduziert werden?
Ohne Zweifel müssen die für das Gelingen von Veränderungen notwendigen Lernprozesse deshalb optimiert werden. Es sollten vor allem erprobte Lernmethoden angewendet werden. Diese sollten klar strukturiert, effizient aber auch attraktiv sein. Lernen gelingt dann immer am besten, wenn Lernen Spaß macht und die Teilnehmer,-innen motiviert sind.
Zum Erlernen neuer Kompetenzen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten sollten Teamtrainings, Workshops und für die Schlüsselpersonen bei Bedarf auch Einzelcoachings eingesetzt werden.
Neben der Verringerung des Energieverbrauchs und damit der Kosten von Veränderung haben solche Lernangebote auch noch einen zweiten nützlichen Effekt. Wichtige Bedürfnisse der betroffenen Mitarbeiter werden befriedigt. Und damit wird neben der Kostenreduzierung auch noch der Gewinn=Anreiz für Veränderung erhöht. Die Bedürfnisse nach Team/Gemeinschaft, Unterstützung, Aufmerksamkeit/Wertschätzung und Weiterentwicklung werden durch geeignete Lernangebote befriedigt. Hierauf wird weiter unten noch ausführlicher eingegangen.
Veränderung sind oft sehr unangenehm. Auch das verursacht Kosten.
Der zweite wichtige Kostenfaktor von Veränderungen entsteht, weil Veränderungen für die Betroffenen oft sehr unangenehm sind. Sie müssen ihre Komfortzone verlassen, in der sie sich vertraut, sicher und angenehm fühlen. Ganz zentrale Bedürfnisse von uns Menschen werden bei Verlassen dieser Komfortzone weniger oder gar nicht mehr befriedigt. Die Bedürfnisse nach Stabilität, Kontrolle, Vorhersagbarkeit, Sicherheit, Vertrautheit u.a.
Aber auch liebgewonnene Gewohnheiten und Strukturen müssen bei Veränderungen aufgegeben werden. Und zu jeder Veränderung gehört immer auch das Risiko, dass der erreichte Zustand nach dem Veränderungsprozess schlechter ist als der Zustand davor. Durch das Verlassen der Komfortzone entstehen also in einem Veränderungsprozess bei uns Menschen eine Vielzahl sehr unangenehmer Gefühle wie: Angst, Ärger, Unsicherheit, Trauer, Resignation, Ohnmacht, ausgeliefert sein.
Unser Gehirn versucht aber solche unangenehmen Gefühle und Zustände zu vermeiden. Auch deshalb mögen viel Menschen Veränderungen nicht.
Wie Können Veränderungsprozesse für die Betroffenen angenehmer gestaltet werden?
Um diesen zweiten großen Kostenfaktor von Veränderung zu reduzieren ist es dringend erforderlich, dass bei den Betroffen das bereits beschriebene Kohärenzgefühl entsteht. Die Veränderungsprozesse sollten also so vorbereitet, gestaltet und durchgeführt werden, dass die Beteiligten sie a. verstehen können, sie b. für sinnvoll erachten und c. auf Planung und Ablauf der Prozesse Einfluss nehmen können. Auf diese Art werden wichtige Bedürfnisse der Beteiligten befriedigt und unangenehme Gefühle reduziert.
Ein Kohärenzgefühl entsteht bei den Betroffenen u.a. durch Transparenz, gemeinsame Gespräche, Beteiligung an der Planung, Berücksichtigung von Vorschlägen und Wünschen, ein angemessen großes Zeitbudget für Vorbereitung und Durchführung von Veränderung. Und natürlich sind klare Strukturen und vorgegebene „Leitplanken“, innerhalb derer die Betroffenen auch selbst kreativ werden können, sehr wichtig.
Ein Veränderungsprojekt wird zum Projekt der Beteiligten
Die Betroffenen der Veränderung also die Mitarbeiter einschließlich der Schlüsselpersonen werden so in den Mittelpunkt des Change-Projektes gerückt. Die für das Gelingen eines Veränderungsprojektes notwendige Prozess-, Projekt-, Zielplanung und der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wird so in den Dienst der Menschen gestellt und nicht umgekehrt. Die beteiligten Mitarbeiter werden zu Handelnden. Das Change-Projekt wird nach ihrem Erleben zu ihrem eigenen Projekt und ist nicht ein fremdgesteuertes Projekt. Ein Projekt, in das sie sich „hineingedrängt“ oder im schlimmsten Fall sogar „hineingezwungen“ fühlen.
Unsere Haltung zueinander macht den entscheidenden Unterschied
Diese Art von Veränderungsmanagement erfordert von den Verantwortlichen eine Haltung von Empathie, Mitgefühl, Achtsamkeit, Verständnis, ernst nehmen, Wertschätzung, Respekt u.a. Eine solche Haltung und die bereits oben beschriebene Denk-, und Handlungsweise gehören bisher aber nicht zum Mainstream unternehmerischer Kultur und Praxis. Deshalb muss hier häufig erst ein Transformationsprozess der Entscheider und Verantwortlichen von Change-Projekten stattfinden.
Wenn Unternehmen aber die Erfolgsrate von Change-Projekten von aktuell niedrigen 25% anheben möchten, ist ein solcher Transformationsprozess unumgänglich.
5. Belohnung und Motivation sind eine wirkungsvolle Stellschraube für die Erhöhung unserer Veränderungsbereitschaft
Wie bereits weiter oben unter Regel 4 geschrieben, läuft nach Ansicht des renommierten Gehirnforschers Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth ohne Belohnung gar nichts. Und Gerhard Roth bezog sich bei dieser Aussage explizit auf das Gelingen von Veränderungsprozessen.
Um die Veränderungsbereitschaft der von Veränderung betroffenen Menschen zu erhöhen, sollte neben der bereits beschrieben Kostensenkung die Belohnung für Veränderung erhöht werden Was sind nun aber Belohnungen und damit Anreize für die Beteiligten in Veränderungsprozessen?
Motivation ist unsere Erwartung, dass wir für unser Handeln belohnt werden
Belohnung ist für uns Menschen zunächst einmal jeder innere Zustand, der sich angenehm anfühlt. Und diesen oben beschriebenen „magischen Cocktail“ an wohltuenden körpereigenen Substanzen in uns auslöst. Dieser Zustand und damit auch Belohnung entstehen immer dann, wenn ein oder mehrere für uns wichtige Bedürfnisse befriedigt werden. Die Motivation für unser Handeln ist demnach unsere Erwartung, dass durch eine bestimmte Verhaltensweise eines oder mehrere dieser Bedürfnisse befriedigt wird. Wir also für unser Handeln belohnt werden.
Die Befriedigung unserer Bedürfnisse ist der Motor für jede Veränderung
Welches sind nun wichtige menschliche Bedürfnisse? Hier wurden weiter oben ja bereits einige genannt. Es sind u.a. die Bedürfnisse nach Sicherheit, Vertrauen, Wertschätzung, Anerkennung, Gemeinschaft, Aufmerksamkeit, Verständnis, Selbstbestimmung, Freiheit, Bedeutung. Die Gewichtung dieser Bedürfnisse und damit deren Bedeutung für die Motivation von Mitarbeitern schwankt mitunter aber deutlich von Mensch zu Mensch.
Dennoch zeigen Untersuchungen und praktische Erfahrungen in der Interaktion mit Menschen, dass viele Menschen in unserem Kulturraum gleichermaßen folgende Bedürfnisse als wichtig erleben: Die Bedürfnisse nach Sicherheit, wahrgenommen und ernst genommen werden, Verständnis, Akzeptanz und Wertschätzung. Wie weiter oben bereits beschrieben, werden aber gerade diese Bedürfnisse der Beteiligten in Change-Projekten häufig zu wenig oder gar nicht berücksichtigt. Das Scheitern eines Change-Projektes ist in solchen Fällen folgerichtig nicht verwunderlich.
Wie kann die Belohnung und damit der Anreiz für Veränderungen erhöht werden?
Sicherlich ist die Fähigkeit, die Belohnungserwartung und damit die Motivation der Beteiligten von Change-Projekten zu steigern, eine besonders wertvolle Kompetenz der Verantwortlichen für Veränderung. Wir können sogar sagen, dass die Fähigkeit, zu motivieren, eine Art besonderer „Kunst“ ist.
Wie schon unter Regel 4 beschrieben wird dem Faktor Motivation und Motivationssteigerung in allen Bereichen von Erziehung, Bildung und Arbeit aber leider immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Dies ist dringend zu ändern, da wir für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und damit Veränderungen viel Kreativität, Engagement und Entschlossenheit der Beteiligten benötigen. Und diese sind ohne hohe Motivation nicht verfügbar.
Motivation kann nicht von außen „Injiziert“ werden
Wie kann nun aber Belohnung, Belohnungserwartung=Motivation bei Mitarbeitern in einem Veränderungsprozess gesteigert werden? Ganz wichtig ist hierfür zunächst einmal die Tatsache, dass dies nur im Teamwork zwischen Mitarbeitern und Schlüsselpersonen geschehen kann. Denn Motivation entwickelt sich in uns Menschen drin und kann nicht von außen injiziert werden.
Ganz wichtig ist es, die Bedürfnisse der beteiligten Mitarbeiter zu kennen
Die Verantwortlichen für Change-Projekte können die beteiligten Mitarbeiter bei deren Motivationssteigerung unterstützen, indem sie folgende Verhaltensempfehlungen nutzen: a. Sie lernen zunächst einmal die jeweilige, individuell unterschiedliche Bedürfnisstruktur der Beteiligten kennen. Dies erfordert tatsächlich ein erhöhtes Maß an Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen bei den Verantwortlichen. b. Auf diese Art entwickeln die Verantwortlichen des Change-Projektes einen Einblick in die Bedürfnisse, die für die einzelnen Beteiligten der Veränderung besonders wichtig sind. Diese Kenntnis nutzen sie, um den Beteiligten zu zeigen, wie diese für sie wichtigen Bedürfnisse im Projekt befriedigt werden können. c. Indem also die Verantwortlichen des Projektes den Beteiligten glaubhaft aufzeigen, welche ihrer Bedürfnisse im Veränderungsprozess befriedigt werden können, bieten sie diesen einen Anreiz für die Mitarbeit im Projekt an.
Die erfolgreiche Motivation von Menschen ist eine besondere „Kunst“
Mit Hilfe dieser einfühlsamen Kommunikation mit den Betroffenen der Veränderung unterstützen die Verantwortlichen des Change-Projektes die beteiligten Mitarbeiter, Ihre Erwartung auf Befriedigung wichtiger Bedürfnisse im Verlauf des Change-Prozesses und damit ihre Motivation für die Mitarbeit zu steigern oder überhaupt erst zu entwickeln.
Wie bereits beschrieben, ist die erfolgreiche Unterstützung von Mitarbeitern bei der Steigerung ihrer Motivation eine besondere Kompetenz, eine Art „Kunst“ der Verantwortlichen eines Veränderungsprozesses. Und diese Kunst kann nur gelingen, wenn die Mitarbeiter auch „mitmachen“, sich also an diesem Prozess der Motivationssteigerung beteiligen.
Ohne Belohnungserwartung=Motivation gelingt kein Veränderungsprozess
So wichtig die Verringerung der Veränderungskosten für die Steigerung der Veränderungsbereitschaft natürlich ist, ohne die Erwartung auf eine Belohnung, ohne Motivation der betroffenen Mitarbeiter wird kein Change-Projekt gelingen. Es lohnt sich also, dass Unternehmen sich auf den Weg machen, die Motivation von Mitarbeitern ernster zu nehmen. Und nach und nach die Fähigkeit zu entwickeln, die Motivation von Mitarbeitern gemeinsam mit diesen zu erhöhen.
6. Einige abschließende Impuls
a. Als einer der ersten Schritte sollten in einem Change-Projekt die Schlüsselpersonen also die Entscheider und Führungskräfte motiviert werden. Denn ein Streichholz, der nicht brennt, kann kein Feuer entzünden
b. Die geplante Veränderung ist ein Team-Projekt. Die beteiligten Mitarbeiter werden zu verantwortlichen Akteuren im Projekt. Das Change-Projekt ist ein gemeinsames Projekt aller Beteiligten
c. Trotz aller sinnvollen und notwendigen Technisierung sind die Menschen immer noch der Schlüssel für das Gelingen von Veränderung. Ohne ihr Mitwirken läuft gar nichts
d. Nur mit ausreichender Motivation beteiligen sich Mitarbeiter nachhaltig an Veränderungsprojekten
e. Der Mensch im Mittelpunkt eines Veränderungsprojektes erfordert Know-how, Zeit und Geld. Aber das Scheitern eine kostenintensiven Veränderungsprojektes und das Ausbleiben einer für das Unternehmen eventuell sogar existentiell wichtigen Veränderung ist deutlich teurer.
Empfehlenswerte Literatur zu diesem Thema:
Roth, G., 11. Auflage: Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten, Stuttgart 2016
Roth, G. / Strüber, S.: Wie das Gehirn die Seele macht, Stuttgart 2014
Roth, G.: Bildung braucht Persönlichkeit, Stuttgart 2011
Roth, G. / de Haan, G.: Interview von Ferdinand Knauß, WirtschaftsWoche, 16.02.2013
Roth, G. / Ryba, A.: Coaching, Beratung und Gehirn, Stuttgart 2016
Esch, T., 3. Auflage: Die Neurobiologie des Glücks, Stuttgart 2017
Esch, T.: Der Selbstheilungscode, Die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit, 2018
Esch, T. / Esch, S.M., 2. Auflage: Stressbewältigung, Berlin 2016
Habits, M.: Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun, was wir tun, 2013
kation.